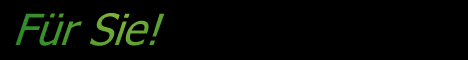Auf den Hund gekommen
Über Dominanz, soziale Gefühle und Evolution
von  › Werner Popken › Werner Popken
Zu den Themen Kommunikation, Tierschutz |
|
|
Die » autistische Verhaltensforscherin » Temple Grandin hat in ihrem Buch » Ich sehe die Welt wie ein frohes Tier nicht nur auf eigene Erkenntnisse und Forschungsergebnisse zurückgegriffen, sondern auch viele Arbeiten anderer Forscher zitiert.
In der letzten Ausgabe haben wir ihre Verwunderung darüber zur Kenntnis genommen, daß Pferde sich überhaupt haben domestizieren und reiten lassen. Das konnte sie sich nur mit den sozialen Bedürfnissen der Pferde erklären.
Pferde brauchen als Herdenwesen nicht nur die Gesellschaft, sondern können es umgekehrt auch zulassen, sich anderen Wesen anzuschließen. Durch ihre Bereitschaft, sich dem Menschen anzuvertrauen, haben sich die Pferde zweifellos verändert. Das Ausmaß dieser Veränderungen läßt sich heute kaum rekonstruieren, da es Pferde in der Wildform nicht mehr gibt.
Ob aber die Menschen ihrerseits von Pferden und durch den Umgang mit ihnen beeinflusst worden sind, hat wohl noch keiner untersucht - aber bestimmt wird sich bald jemand dieser Aufgabe annehmen, da die wechselseitige Beeinflussung von Menschen und Hunden seit einiger Zeit in der Wissenschaft heiß diskutiert wird.
Temple Grandin zitiert einen Artikel über die Arbeit einer australischen Forschungsgruppe, publiziert im Februar 1998, die zu dem Schluß gekommen ist, daß sich Hunde und Menschen gegenseitig beeinflusst und geformt haben, wir Menschen also so sind, wie wir sind, weil wir uns mit Hunden zusammengetan haben: » Theory suggets greater role for man's best friend (theoretische Überlegungen legen eine größere Rolle für des Menschen besten Freund nahe).
Aber das ist nicht die einzige Stimme, die in diese Richtung weist: Der österreichische Verhaltensforscher » Wolfgang Schleidt, nach dem Zweiten Weltkrieg wichtiger Mitarbeiter des allgemeinen bekannten Verhaltensforschers » Konrad Lorenz, veröffentlichte im Dezember 1998 einen Aufsatz  » Is Humaneness Canine? (Ist Menschlichkeit hündisch?), der die spezifische Menschlichkeit mit wesentlichen Verhaltenseigenschaften von Wölfen verbindet, und wiederholte diese Gedankengänge noch einmal 2003 in » Is Humaneness Canine? (Ist Menschlichkeit hündisch?), der die spezifische Menschlichkeit mit wesentlichen Verhaltenseigenschaften von Wölfen verbindet, und wiederholte diese Gedankengänge noch einmal 2003 in  » Co-evolution of Humans and Canids (Gemeinsame Evolution von Menschen und Hunden). » Co-evolution of Humans and Canids (Gemeinsame Evolution von Menschen und Hunden).
Sein Lehrer Konrad Lorenz hatte schon 1954 bemerkt, daß die menschliche Fähigkeit, wahre Freundschaft unabhängig von verwandtschaftlichen Beziehungen zu zeigen - die von dieser Generation gerade in den schrecklichen Kriegszeiten und in der Gefangenschaft nachdrücklich erfahren werden konnte -, im ganzen Tierreich im Grunde unbekannt ist und am ehesten noch bei Hunden beobachtet werden kann. Schleidt zitiert darüber hinaus die berühmte Schimpansen-Forscherin » Jane Goodall, die es für ausgeschlossen hält, selbst nach hunderten von Jahren selektiver Züchtung die Art von Anhänglichkeit in Schimpansen zu erzeugen, für die Hunde ganz generell bekannt, beliebt und berühmt sind. Donnerwetter: Selbst unsere nächsten Verwandten im Tierreich sollen sich vollkommen anders verhalten und nicht einmal Ansätze zu selbstlosem Verhalten zeigen, die man züchterisch verstärken könnte!
| |







 neu: jetzt auch unter
neu: jetzt auch unter